Daniel wagt
es nicht, in den Rückspiegel zu schauen. Aus Furcht vor dem, was er dort sehen
könnte, oder auch nicht sehen würde, starrt er wie gebannt auf die Straße vor
ihm. Die Mittelstreifen verschwimmen zu einer durchgängigen Linie und es kostet
Daniel von Minute zu Minute mehr Kraft, nicht doch einmal einen Blick zur Seite
oder gar nach hinten zu werfen. Nicht jetzt.
Vor etwa
einer halben Stunde, als die Welt noch in Ordnung war, hat er die Nachricht
seiner Frau erhalten, die Wehen hätten eingesetzt. Daniel war gerade in seinem
Büro gewesen, hatte alles stehen und liegen gelassen und war in die Tiefgarage
zu seinem Benz geeilt. Eine Minute später war seine Kollegin Michaela, die
gerade vor dem Gebäude eine Zigarette rauchte, zu Staub zerfallen. Daniel
bemerkte das erst auf den zweiten Blick, den er nach links warf, um zu sehen,
ob die Fahrbahn frei wäre.
Sein Herz
setzte aus. Wieso ausgerechnet jetzt, wo er doch all die Jahre Ruhe gehalten
hat? Unter großer Anstrengung wischte er den Gedanken an seine Kollegin und wen
es sonst noch erwischt haben mochte zur Seite und trat das Gaspedal durch.
Das erste Mal
hatte ihn der Tod – oder wie er es nannte: der Verfall aller Dinge – in seiner
Jugendzeit besucht. Zumindest konnte er sich an keine frühere Begegnung
erinnern. Daniel war gerade durch den Wald gejoggt – angetrieben von dem
athletischen Aussehen seiner Mitschüler – als er hinter sich ein Rascheln
vernahm. Er zuckte leicht zusammen, während seine letzten Gedanken an seine
Klassenkameradin Kira ins Nirwana flogen, und drehte sich um.
Er vermutete,
dass ein solches Rascheln meist von einem kleinen Tier – etwa einem
umherhüpfenden Vogel – verursacht wurde, doch an diesem Tag entsprach nichts
dem, was man Normalität nennen mochte. Die Quelle des Geräuschs war tatsächlich
ein kleiner Vogel gewesen. Jedoch war dieser Vogel nicht durchs Laub gehüpft,
sondern tot vom Himmel gefallen.
Daniel bückte
sich nach dem kleinen Geschöpf. Er hob einen Zweig auf, um den Vogel damit auf
die andere Seite zu drehen. Doch, als er das Tier berührte, gab das Gefieder
nach und der kurze Ast stieß durch bis auf den trockenen Waldboden. Im Vogel
klaffte ein Loch, wie von einer Gewehrkugel, als hätte ihn jemand vom Himmel geschossen. Jedoch waren die Ränder
dieser Wunde nicht ausgefranst und Blut konnte Daniel auch keines sehen. Es sah
vielmehr so aus, als sei der Vogel durch die Berührung des Astes zu Staub
zerfallen.
Aus Angst, er
könne sich durch den Kadaver mit irgendwelchen dubiosen Krankheiten infizieren,
ließ er den Vogel achtlos liegen und lief weiter. Am Ende seiner Laufstrecke
blieb Daniel atemlos stehen und dehnte seine Beinmuskulatur. Als er sich
umdrehte, um den Weg, den er gekommen war zurückzulaufen, sah er den
Schmetterling.
Der Falter
saß auf einem Grashalm und schlug mit den Flügeln. Mit einem Mal klappte sein
linker Flügel nach unten, während der rechte sich weiter auf und ab hob. Daniel
sah das Insekt genauer an. Dabei bemerkte er einen feinen Riss, der sich durch
den Falter zog, wie ein Riss in der Tapete. Entlang dieser dünnen Linie schien
alles Leben aus dem Tier gewichen zu sein. Der linke Flügel wirkte irgendwie
farbloser und der Fühler auf der linken Seite war kurz oberhalb des Kopfes
abgeknickt, wie ein Grashalm, der dem starken Wind nicht gewachsen war.
Vorsichtig
griff Daniel nach dem Schmetterling und berührte dessen linken Flügel. Er
spürte, wie der Flügel in sich zusammenfiel, wie die Asche eines verbrannten
Blatt Papiers. (Daniel hatte einmal eine Mathearbeit verbrannt, die er
unmöglich seinen Eltern zeigen konnte.) Der Falter kam, jetzt, da ihm ein
Flügel fehlte, aus dem Gleichgewicht und kippte nach rechts.
Auf seinem
Weg zurück bemerkte Daniel noch weitere Veränderungen in der Natur. Einige
Bäume hatten ihre Blätter verloren. Drei Bäume waren gar ganz umgestürzt. Es
schien, als habe eine schreckliche Macht das Leben aus allem gesogen. Erst nach
etwas mehr als einem Kilometer ließen diese Veränderungen nach. Hier blühten
wieder alle Bäume und die Tiere huschten durchs Gestrüpp. Daniel blieb stehen
und blickte über die Schulter zurück. Der Anblick, der sich ihm bot, nahm ihm
den Atem.
Links und
rechts des Weges türmten sich herabgefallene Äste, der Waldboden war übersäht
mit verfaulten Blättern und genau in dem Moment, als Daniel sich umdrehte,
stürzten drei weitere Vögel leblos vom Himmel.
Nur mit Mühe
konnte Daniel sich aus seiner Erstarrung lösen. Als es ihm gelang, drehte er
sich um und rannte so schnell er konnte zurück zu seinem Fahrrad, das er am
Waldrand an einen Baum gekettet hatte.
Daniel lenkt
den Benz über die Bundesstraße. Die nächste Ausfahrt ist seine. Er setzt den
Blinker und fährt, ohne in den Spiegel zu sehen, auf den Verzögerungsstreifen.
Vor ihm kriecht ein alter Golf über die Fahrbahn. Daniel tritt auf die Bremse.
Dann wirft er einen kurzen Blick auf das Display seines Smartphones. Susanne
hat ihm keine weitere Nachricht geschickt. Er weiß nicht, ob er das gut oder
schlecht finden soll. Gedankenverloren legt er sein Mobiltelefon auf den
Beifahrersitz. Als er seinen Blick wieder auf die Straße wirft, streift er kurz
den Innenspiegel. Das Blut gefriert in seinen Adern.
Hinter ihm
fällt ein verrosteter alter Laternenpfahl in sich zusammen, die Straße ist
brüchig und dort wo einige Büsche am Straßenrand gestanden haben, klafft ein
Loch in der Realität, wie ein Loch in einer Mauer, auf die jemand mit einem
schweren Hammer eingeschlagen hat. Daniel kann seinen Blick nur schwer vom
Spiegel losreisen. Seine Schläfen pochen. Großer Gott, hinter dem Loch war
nichts. Keine Wirklichkeit!
Daniel war
einige Tage später noch einmal in den Wald zurückgekehrt. Die Natur hatte sich
wieder etwas erholt. Das Forstamt hatte die umgestürzten Bäume an den Wegesrand
geschafft. Daniel suchte den Waldboden konzentriert ab, konnte jedoch keinen
Vogelkadaver finden. „Im Wald bleibt nichts liegen“, hatte sein Biolehrer immer
gesagt. Daniel war sich nicht sicher, ob das Verschwinden der toten Vögel auf
die anderen Tiere zurückzuführen war. Er glaubte vielmehr, dass sie einfach zu
Asche zerfallen waren. Als er die Stelle erreichte, an der er einige Tage zuvor
umgekehrt war, blieb er stehen. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Langsam
schloss er seine Augen, atmete tief ein und wieder aus und dreht sich dann um.
Als er seine Augen wieder öffnete, bot sich ihm das gewohnte Bild. Die Blätter
hingen alle noch an den Bäumen, die Vögel flogen weiterhin durch die Luft oder
hüpften über den Boden und die Insekten schwirrten umher. Dennoch spürte Daniel
ein Gefühl der Beklemmung. Er wusste nur nicht, wieso. Erst, als er spät in der
Nacht in seinem Bett lag, wurde ihm klar, woher dieses Gefühl gekommen war: Er
hatte nichts gehört. Der Wald war vollkommen still gewesen.
Der Verfall
aller Dinge war ihm nur noch zweimal über den Weg gelaufen. In keinem der Fälle
hatte Daniel ihn kommen sehen. Er kam unangekündigt, wie die Zeugen Jehovas
oder ein Landstreicher, der an der Tür klingelte und nach etwas Geld fragte.
Das zweite
Mal trafen sie aufeinander, als Daniel kurz vor seiner letzten Abiturprüfung
stand. Er war nach dem Unterricht etwas länger in der Schule geblieben, um in
der Bibliothek noch etwas zu recherchieren. Nach einer Stunde bekam er so
starke Kopfschmerzen, dass er beschloss, das Lernen für diesen Tag
einzustellen. Er nahm die geliehenen Bücher und trug sie zurück zu den
entsprechenden Regalen.
Schon von
weitem konnte er sehen, dass die anderen Bücher, die sich in dem Regal
befanden, alt und verrottet waren. Die Einbände waren schimmlig geworden, die
Farbe blätterte ab und das Papier war brüchig und vergilbt. Daniel wusste sich
nicht anders zu helfen, als seine drei Bücher in das Regal zu legen und die
Bibliothek durch den Hinterausgang zu verlassen. Er war direkt zur
Bushaltestelle gegangen und nachhause gefahren. Seitdem hatte er nie wieder
einen Fuß in die Bibliothek gesetzt.
Ihre dritte
und bisher letzte Begegnung hatten Daniel und der Tod vor etwas über drei
Jahren während eines Theaterbesuchs. Daniel war in der Pause auf die Toilette
gegangen. Als er sich die Hände wusch und währenddessen im Spiegel betrachtete,
fiel sein Blick auf den Mann, der gerade eben aus der Kabine kam. Er hatte
langes, weißes Haar, dass ihm ungekämmt ins Gesicht hing und gelbe, lange,
brüchige Fingernägel, die an mehreren Stellen eingerissen waren. Das
erschreckendste war jedoch seine Haut. In seinem Gesicht hatten sich Blasen
gebildet und von seiner Stirn hing ein großer Lappen blauer Haut herab. In der
dort entstandenen Lücke klaffte das Nichts.
Daniel
erbrach sich ins Waschbecken und verließ das Theater ohne, sich noch einmal
umzudrehen. Erst als er draußen war, schrieb der Susanne eine SMS. Dann wartete
er vor dem Eingang, den Blick auf die Tür gerichtet. Er wollte seiner Frau ins
Gesicht sehen, wenn sie die Treppe herunterkam. Er wollte auf keinen Fall
hinter sich blicken. Und auf keinen Fall würde er jemals wieder leichtsinnig in
einen Spiegel schauen.
Daniel
erreicht sein Haus eine halbe Stunde, nachdem er sein Büro verlassen hat. Er
lässt den Wagen in der Einfahrt stehen und rennt, ohne noch einmal hinter sich
zu sehen, den kurzen Weg zur Haustür hinauf. Vor der Tür fällt ihm der
Schlüssel aus der Hand, so schweißnass sind seine Finger. Er hebt ihn auf und
öffnet die Tür. Dann tritt er ein. Er weiß, dass Susanne oben im Schlafzimmer
liegen wird (der Arzt hat ihr Bettruhe verordnet), trotzdem ruft er nach ihr.
Ihre Stimme gibt ihm recht. Er eilt die Treppe nach oben, bleibt jedoch auf
halber Strecke stehen. Mit pochendem Herzen dreht er sich um und rennt runter
in die Küche, um eine Schere zu holen.
Als er wieder
die Treppe hochläuft, sieht er die feinen Risse in der Tapete und die
Wurmlöcher im Treppengeländer. Er ist da. Der Verfall aller Dinge.
Daniel öffnet
die Schlafzimmertür und schließt sie sofort wieder, als er den Raum betreten
hat. Er schließt sie, ohne sich umzudrehen. Er wagt es nicht, seiner Frau den
Rücken zuzudrehen. Nicht jetzt. An ihrem Gesichtsausdruck versucht er
abzulesen, ob ihr die vermoderte Tapete im Flur aufgefallen ist. Sie blickt ihn
völlig normal an.
„Da bist du
ja endlich.“
„Es tut mir
leid, aber vor mir fuhr eine alte Oma ihren klapprigen Golf spazieren.“
„Fahr mich
bitte ins Krankenhaus.“
Daniel hat
damit gerechnet, dass Susanne das verlangen wird. Er schüttelt den Kopf. „Das
geht nicht.“
„Wieso?“
Weil er
wieder da ist. Daniel schweigt zunächst. Dann legt er die Schere auf das Bett.
„Wir erledigen das selbst.“
„Ich will
keine Hausgeburt!“ Susanne sieht in Daniels Augen, dass er nicht bereit ist,
von seinem Vorhaben abzurücken. „Ruf wenigstens Maria an.“ Daniel überlegt
einen Moment, ob er es riskieren kann, die Hebamme hinzuzuziehen, dann
schüttelt er langsam den Kopf.
„Es geht
nicht. Es tut mir so leid.“
Irgendwas an
seinem Blick macht Susanne Angst. Sie kann es nicht genau ausmachen, doch sie
weiß, dass sie sich zurecht fürchtet. Sie weiß, dass sie sich vor allem um ihre
Tochter sorgen machen muss.
Daniel
umrundet das Bett. Dabei ist sein Blick fest auf Susanne fixiert. Er geht
rückwärts in das kleine Badezimmer und holt einige Handtücher. Dann steht er
etwas ratlos im Schlafzimmer. Schließlich fragt er: „Wie häufig kommen die
Wehen?“
„Etwa alle
fünf Minuten. Es verwundert mich, dass du bisher noch keine mitbekommen hast.“
Kaum hat sie es ausgesprochen, als auch schon die nächste Wehe einsetzt.
„Würdest du jetzt bitte Maria anrufen und herbitten?“ Es ist mehr eine
Aufforderung als eine Frage. Daniel denkt fieberhaft nach. Schließlich zieht er
sein Smartphone aus seiner Tasche. Er entsperrt es und blickt auf das Display.
In der Scheibe spiegelt sich die Gardine hinter ihm. Augenblicklich zerfällt
sie zu Staub. Susanne schreit laut auf.
„Ich kann sie
nicht anrufen. Die Welt würde zerfallen. Verstehst du das denn nicht?“ Daniel
sieht dem Gesicht seiner Frau an, dass sie nichts versteht. Aber da ist noch
etwas in ihrem Blick. Durch die Verzweiflung hindurch scheint etwas, das Daniel
für Vertrauen hält. „Wir werden das auch ohne Marie schaffen.“ Er nimmt
Susannes Hand und drückt sie fest. Susanne nickt. Dann fängt sie an zu
schreien.
„Es geht
los!“
Und es geht
los. Susanne drückt immer fester Daniels Hand. Das Smartphone liegt
mittlerweile achtlos auf dem Fußboden. Etwas knackst in Daniels Hand. Susanne
atmet jetzt immer hektischer. Daniel versucht sich an die Dinge zu erinnern,
die sie gemeinsam mit der Hebamme besprochen haben. Verzweifelt versucht er,
seine Hand aus Susannes festem Griff zu lösen. Als ihm das nicht gelingt, geht
er in die Knie und streicht mit der freien Hand sanft über Susannes Kopf. Sie
entspannt sich ein wenig, ohne jedoch den Griff um Daniels Hand zu lockern.
Ihre Atmung ist jetzt kontrollierter.
Auf einmal
kann sich Daniel doch an etwas aus den Vorbereitungskursen erinnern: Eine
Geburt kann zwischen acht und fünfzehn Stunden dauern. Er versucht noch ein
letztes Mal, sich aus dem Griff seiner Frau zu befreien. Schließlich gibt er
auf und denkt nur noch, dass es ja auch irgendwie fair ist, dass er ebenfalls
Schmerzen ertragen muss.
Keine fünf
Stunden später legt Daniel die Schere weg, mit der er zuvor die Nabelschnur
durchtrennt hat. Seine Tochter weint lauthals, was Daniel zunächst besorgt
registriert, bis er sich daran erinnert, dass es sich nur um ein Zeichen dafür
handelt, dass das Baby Luft bekommt.
Susanne liegt
völlig erschöpft in ihrem Bett. Das Bettzeug ist blutverschmiert. Daniel
lächelt seiner Frau zu während er seine Tochter im Arm wiegt. Er ist so
fasziniert von dem kleinen Geschöpf in seinen Händen, dass er sich
gedankenverloren im Kreis dreht. Als er seine Frau das nächste Mal sieht, ist
sie allem Anschein nach tausend Jahre alt. Daniel lässt vor Schreck beinahe
seine Tochter fallen. Er stürzt auf das Bett zu. Das Holzgestell ist überall
morsch, die Blutlache auf dem Laken ist völlig vertrocknet. Das Bettzeug ist zu
Staub zerfallen. Susannes Haut ist nahezu an jeder Stelle ihres Körpers
abgefallen und liegt wie feine Asche neben dem schwarzen Skelet. Ihre Haare
sind grau.
Daniel
schießen die Tränen in die Augen. Als er anfängt laut und ohne Scham zu weinen,
beginnt auch seine Tochter in seinen Armen zu schreien. Er drückt sie jetzt
fester an sich und wiegt sie hektisch hin und her, wodurch sie nur noch lauter
weint. Daniel steht hilflos inmitten eines toten Schlafzimmers und weint, bis
seine Tränen versiegen, schreit lautlos in die Nacht, bis seine Kehle
vertrocknet.
Daniel hat
aufgehört zu weinen. Er ist mit Susanna – er hat es nicht übers Herz gebracht,
seiner Tochter den Namen ihrer Mutter zu geben – nach unten ins Wohnzimmer
gegangen. Die Treppenstufen haben unter seinem Gewicht leicht nachgegeben. Die
Tapete im Flur und auf der Treppe ist mittlerweile in ihre Bestandteile zerfallen
und hängt ausgebleicht lose an der Wand.
Susanna liegt
jetzt auf einer Wolldecke auf dem Fußboden und spielt vergnügt mit einem
kleinen Plastikball, den sie immer wieder fallen lässt. Daniel hebt ihn jedes
Mal auf und reicht ihn ihr. Susanna nimmt ihn unbeholfen in ihre kleinen Hände
und quietscht fröhlich, als sie ihn ein weiteres Mal wegwirft. Reflexartig
dreht Daniel sich nach dem Ball um, der unter den Klavierhocker rollt und
erstarrt mitten in der Bewegung. Sein Herz hört auf zu schlagen und in seinem
Hals bildet sich ein Kloß, der ihm den Atem nimmt. Daniels Lippen zittern
unkontrolliert. Angespannt horcht er in die Stille, doch da ist nichts. Kein
Ticken einer Uhr, kein Atemgeräusch seiner Tochter. Wäre doch wenigstens das
Rascheln eines herumhüpfenden Vogels zu hören. Daniel fegt diesen Gedanken zur
Seite.
Plötzlich
hört er doch etwas. Ein leiser Atemzug seiner Tochter. Daniel fallen ganze
Gebirge vom Herzen. Dann beginnt Susanna qualvoll zu schreien.
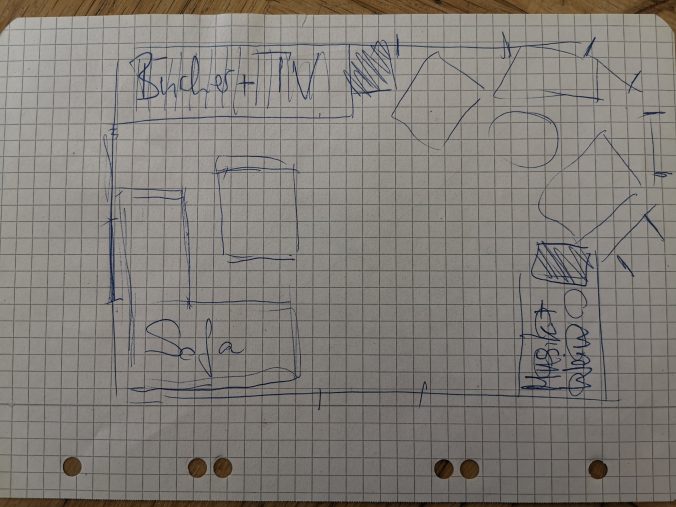
Neueste Kommentare